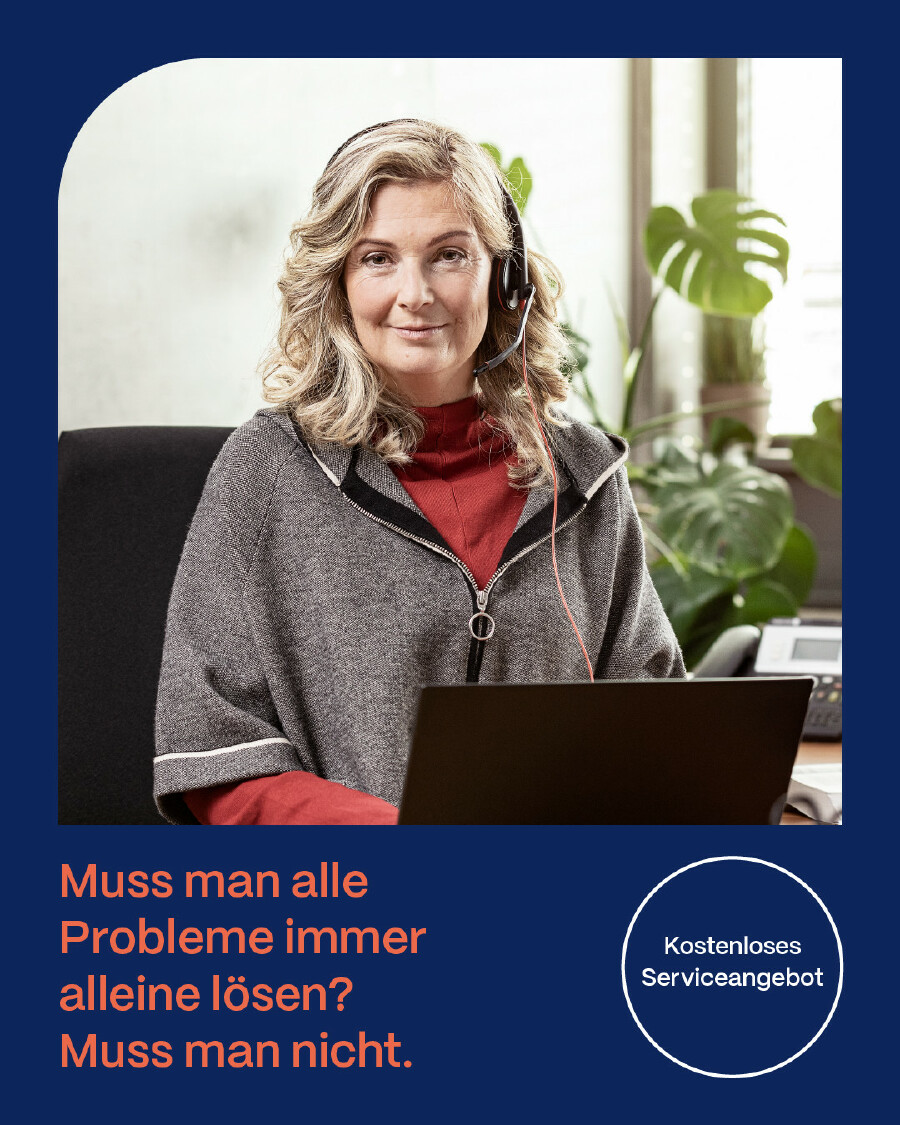Neue Studie der Universität Wien zeigt: Vielfältige Hürden erschweren Inanspruchnahme elementarer Bildung in Vorarlberg
Trotz hoher Besuchsquoten verbringen Kinder in Vorarlberg deutlich weniger Zeit in früher Bildung als im Rest Österreichs. Eine neue Studie des Österreichischen Instituts für Familienforschung (ÖIF), der Universität Wien, beauftragt von der AK Vorarlberg, zeigt: Strukturelle Barrieren und traditionelle Rollenbilder bremsen den Zugang und die Inanspruchnahme von elementaren Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.
Vorarlberg steht bei der Nutzung elementarer Bildungs- und Betreuungseinrichtungen vor einer paradoxen Situation: Zwar besuchen überdurchschnittlich viele Kinder im Alter von eins bis unter sechs Jahren eine Einrichtung – doch die tatsächliche Besuchsdauer ist österreichweit am geringsten. Eine neue Studie des Österreichischen Instituts für Familienforschung (ÖIF), der Universität Wien, durchgeführt im Auftrag der AK Vorarlberg, zeigt: Strukturelle Barrieren, Qualitätsbedenken und tief verwurzelte Rollenbilder sind die Gründe für die geringe Inanspruchnahme ganztägiger Betreuung.
Hohe Besuchsquote, aber kurze Betreuungszeiten
Die Zahlen wirken auf den ersten Blick positiv: 98 Prozent der Vier- bis Sechsjährigen in Vorarlberg besuchen eine Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtung, rund 90 Prozent bei den Dreijährigen, ebenso mehr als zwei Drittel der Zweijährigen (67 Prozent) und über ein Drittel der Einjährigen. Damit liegt Vorarlberg in allen Altersgruppen über dem österreichischen Durchschnitt.

Doch beim genaueren Hinsehen zeigt sich ein anderes Bild: „Eine hohe Besuchsquote sagt wenig darüber aus, wie viel Zeit die Kinder tatsächlich in elementaren Bildungseinrichtungen verbringen“, führt AK Bildungsexperte Linus Riedmann aus. Der Anteil an Kindern in ganztägiger Betreuung oder auch nur über Mittag ist in Vorarlberg mit Abstand der geringste im Bundesvergleich. Während österreichweit mehr als die Hälfte aller Kinder ganztägig betreut werden, sind es in Vorarlberg lediglich rund 18 Prozent.

Wissenschaftliche Analyse identifiziert Barrieren

Die Studie des ÖIF an der Universität Wien, durchgeführt im Auftrag der AK Vorarlberg, basiert auf Tiefeninterviews mit Eltern und liefert erstmals eine fundierte Analyse der Gründe, warum viele Familien frühe Bildungsangebote nur eingeschränkt oder gar nicht nutzen. AK Präsident Bernhard Heinzle betont: „Wer Vertrauen schaffen will, muss die Perspektive der skeptischen Eltern verstehen. Nur so lassen sich politische Handlungsfelder identifizieren und Hürden gezielt abbauen.“
Die Ergebnisse zeigen ein komplexes Zusammenspiel aus:
- Wunsch nach familiärer Eigenbetreuung
- Skepsis gegenüber institutioneller Bildung
- Fehlenden Betreuungsplätzen und mangelnder Flexibilität
- Kostenbelastung und Unsicherheit über die Qualität der Einrichtungen

„Familien haben unterschiedliche Bedürfnisse und Alltagsrealitäten, das kann man in den Interviews sehr gut erkennen“, so die Studienautorin Dr. Christine Geserick. Wo manche Eltern fehlende oder zu teure Plätze kritisieren, erleben andere einen großen Druck, die „richtige“ Entscheidung für ihr Kind zu treffen. Vor allem Mütter erfahren oft widersprüchliche gesellschaftliche Ansprüche und werden entweder als „Karrierefrau“ oder „Gluckenmutter“ bezeichnet. Was aber alle Eltern eint, ist der Wunsch, ihren Kindern die bestmögliche Zuwendung und Förderung zu ermöglichen. „Gerade deshalb braucht es qualitativ hochwertige Angebote.“
Qualität als Schlüssel zum Erfolg früher Bildung
Die Studie unterstreicht einen wissenschaftlichen Konsens: Frühkindliche Bildung entfaltet ihr volles Potenzial nur bei hoher Qualität. „Aus bisherigen, international vergleichenden Studien wissen wir bereits, dass die Qualität darüber entscheidet, ob frühe Bildung wirkt. Die wahrgenommene Qualität entscheidet aber auch darüber, ob Eltern überhaupt Vertrauen fassen“, so Geserick. Die AK Vorarlberg kritisiert in diesem Zusammenhang den Förderstopp für Elternbeiträge in privaten Einrichtungen für Dreijährige. „Statt Qualität zu stärken, wird sie gefährdet“, warnt Heinzle. „Wir brauchen einen regionalen Aktionsplan, der Ausbau und Qualität gemeinsam denkt – nicht Rückschritte.“
Die AK Vorarlberg hat bereits vor Inkrafttreten des Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes im Rahmen der Studie „Frühe Bildung in Vorarlberg“ einen Fokus auf den Ausbau und die Qualität sowie einen begleitenden umfassenden Aktionsplan zur Implementierung des Gesetzes gefordert. „Eine ernsthafte Überarbeitung des Gesetzes wäre die Chance für das Land, beides nachzuholen“, hält Heinzle fest. Wie wichtig es ist, in Vorarlberg in mehr Bildungsqualität zu investieren, hat auch die Anfang 2025 präsentierte AK Personalbefragung gezeigt, an der rund 1.700 Elementarpädagog:innen teilgenommen haben.
Traditionelle Rollenbilder in Vorarlberg besonders ausgeprägt
Im Rahmen der Studie hat das ÖIF erstmals Daten aus dem „Generations & Gender Programme (GGP)“ spezifisch für Vorarlberg ausgewertet. Die Ergebnisse beleuchten gesellschaftliche Erwartungen an Mütter im Hinblick auf Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit – und zeigen für Vorarlberg ein deutlich konservativeres Bild als in anderen Bundesländern.
52 Prozent der Männer in Vorarlberg stimmen der Aussage zu, dass ein Kind, das noch nicht zur Schule geht, unter der Erwerbstätigkeit der Mutter leiden würde. Auch 30 Prozent der Frauen teilen diese Ansicht. Zum Vergleich: In Wien liegt die Zustimmung bei 28 Prozent der Männer und
18 Prozent der Frauen.
Auch beim idealen Erwerbsausmaß für Mütter eines zweijährigen Kindes zeigt sich ein klarer Unterschied: Rund 83 Prozent der Frauen in Vorarlberg halten 20 Wochenstunden oder weniger für ideal – in Wien sind es 53 Prozent, in Dänemark lediglich rund acht Prozent.
„Sowohl die Zahlen aus dem GPP als auch die Auswertung der Interviews zeigen, wie tief verwurzelt traditionelle Rollenbilder in Vorarlberg noch immer sind – das spüren wir auch in der Beratung immer wieder“, unterstreicht Eva Fischer-Schweigkofler, Leiterin der AK Abteilung Familie und Beruf. „Was helfen kann, den Erwartungsdruck zu reduzieren, der spürbar auf den Müttern lastet, wäre eine partnerschaftliche Aufteilung von Erwerbsarbeit und unbezahlter Care-Arbeit. Gesetzlich ist das schon lange möglich. In unserer Beratung informieren wir gerne darüber.“

Konkrete politische Handlungsfelder
„Die Studie liefert klare Kategorien, aus denen die Politik gezielt Maßnahmen ableiten kann – um Vertrauen zu schaffen und Hürden abzubauen“, erklärt AK Bildungsexperte Riedmann. Besonders dringlich ist der Handlungsbedarf bei jenen Eltern, die durch strukturelle Barrieren oder mangelndes Vertrauen in die Qualität von früher Bildung abgehalten werden.
AK Präsident Heinzle betont: „Es geht nicht nur darum, dass genügend Plätze vorhanden sind. Was es braucht, liegt auf dem Tisch. Die Arbeiterkammer setzt sich seit Langem für einen Rechtsanspruch auf kostenlose, flächendeckende und qualitativ hochwertige frühe Bildung ein.“
Auch in der jüngsten Dialoggruppe des Landes zur elementaren Bildung hat die AK Vorarlberg gemeinsam mit anderen Akteuren zahlreiche Verbesserungen angeregt. „Jetzt kommt es darauf an, dass diese Impulse in eine echte Reform münden – mit einem Maßnahmenplan, der die verbliebenen Hürden konsequent adressiert“, so Heinzle abschließend.
AK fordert Verbesserungen im Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz
Die AK Vorarlberg fordert einen umfassenden regionalen Aktionsplan, der strukturelle Hürden abbaut, Qualität stärkt und gesellschaftliche Rollenbilder thematisiert.
Strukturelle Hürden abbauen
- Stufenweiser Ausbau des Versorgungsauftrags mit dem Ziel eines Rechtsanspruchs auf Elementarbildung
- Schrittweise Ausweitung der sozialen Staffelung – Ziel: kostenlose, ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote
- Mehr Flexibilität bei der Wahl des Betreuungsplatzes (z. B. entlang des Arbeitswegs)
Qualität verbessern
- Entlastungspersonal für Pädagog:innen
- Verbindliche Standards für Assistenzkräfte
- Maßnahmen zur Verbesserung von Gruppengrößen und Betreuungsschlüssel
Rollenbilder und Bewusstseinsbildung
- Positive Potenziale früher Bildung sichtbar machen
- Erwartungsdruck auf Mütter reduzieren
- Partnerschaftliche Aufteilung von Erwerbs- und Care-Arbeit fördern
Zitate der Eltern
Die Studie identifiziert zwei Leitmotive. Während eine Gruppe von Eltern gern die frühe Bildung der Kinder aus Überzeugung selbst oder in der Familie übernimmt, scheitert die institutionelle frühe Bildung für andere an strukturellen Hürden. Für die AK ist klar: Es gilt Hürden abzubauen, Vertrauen durch Qualität zu schaffen und Rollenbilder zu thematisieren und offen zu diskutieren
- „Wenn wir Kinder kriegen, möchten wir das selber schaukeln können.“
- „Ich finde, daheim ist das Kind einfach am besten betreut.“
- „Die ersten Jahre sind so prägend, und die möchte ICH einfach in erster Linie machen.“
- „Ich will normal arbeiten – aber Spielgruppe ist fünf Stunden Maximum.“
- „Die, die Vollzeit arbeiten, werden natürlich bevorzugt.“
- „Es war mir einfach zu hart. Ich habe sie dann abgemeldet.“
- „Vollzeitbetreuung, das musst du dir finanziell leisten können!“
„Wenn es jetzt genügend Plätze geben würde, würde ich sie sicher dorthin schicken.“
Downloads
Kontakt
Kontakt
AK Vorarlberg
Öffentlichkeitsarbeit
Widnau 4
6800 Feldkirch
Telefon +43 (0)50 258 1600
oder 05522 306 1600
Fax +43 50 258 1601
E-Mail presse@ak-vorarlberg.at