Bildung
Vorarlbergs schlimmste Nationalsozialisten
Anlässlich von 40 Jahren Johann-August-Malin-Gesellschaft veröffentlicht die Vorarlberger Autorengesellschaft den 17. Band der „Studien zur Geschichte und Gesellschaft Vorarlbergs“.

In diesem Beitrag
Der 8. Mai ist ein geschichtsträchtiger Tag. Am 8. Mai 1945 schwiegen die Waffen. Das lehren uns die Geschichtsbücher. Der Zweite Weltkrieg war zu Ende. Das große Schlachten hatte mehr als 60 Millionen Menschenleben gefordert. In Vorarlberg waren 868 Menschen tot und 8600 vermisst. Wir nennen den 8. Mai „die Stunde Null“. Ganz so, als gäbe es eine schlechte Welt davor und eine gute danach. Trennscharf geschieden.
Aber die Stunde Null ist eine Fiktion. Es waren ja alle noch da, sofern sie überlebt hatten: Die Opfer und die Täter, die gejubelt und die geschwiegen hatten. Die Nachbarn. Und alle mussten sie jetzt erneut in ein Zusammenleben finden. Man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Und doch ist es geglückt, sonst wären wir heute nicht hier. „Das Verzeihen-Können ist ein magischer Akt“, sagt Natalie Knapp, „es setzt enorme Kräfte frei und macht uns wieder gemeinschafts- und beziehungsfähig“.
Beim Verzeihen geht es nicht in erster Linie darum, die Täter zu entlasten. „Das ist ein Missverständnis.“ Knapp bezieht sich auf die große US-amerikanische Traumatherapeutin und Auschwitz-Überlebende Edith Eger. Sie hat mit 90 Jahren ihr Leben in das Buch "Ich bin hier und alles ist jetzt" gefasst. Sie schreibt darin: „Nichts ist gewonnen, wenn wir den Tätern einen Persilschein ausstellen oder auf Rechenschaft verzichten.“ Von ihren Mitüberlebenden habe sie allerdings gelernt, dass es zwei Wege gibt mit dem erlittenen Unrecht umzugehen. Man könne dafür leben, sich an der Vergangenheit zu rächen, /oder /man könne dafür leben die Gegenwart zu bereichern. Anstatt im Gefängnis der Vergangenheit steckenzubleiben, könne man sich auch dafür entscheiden, die Vergangenheit als Sprungbrett zu nutzen, um das Leben zu erreichen, das man jetzt leben will.
Edith Eger geht davon aus, dass man sich aus dem emotionalen Gefängnis der Vergangenheit befreien kann, wenn man die Sehnsucht nach Vergeltung überwindet. Der Mensch hat immer eine Wahl. Sie hat es selbst erlebt und auch viele andere Menschen dabei begleitet.
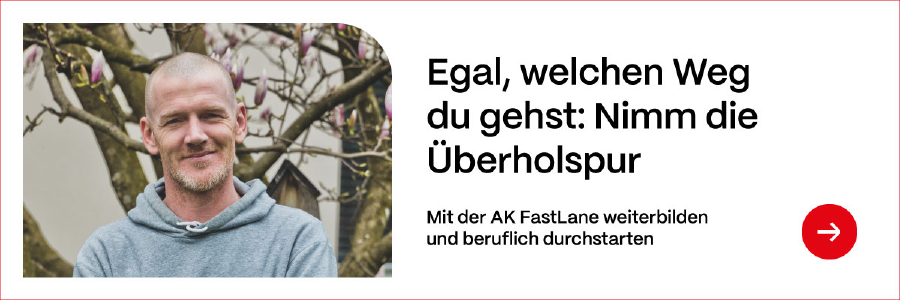
„Weil die Wege vielfältig und die Prozesse nicht so leicht zu verstehen sind“, erläuterte Natalie Knapp in ihrem Vortrag „5 grundlegende Dinge, die man über das Verzeihen wissen sollte.“
"Wenn der Kasperl dem bösen Krokodil eins überbrät, ist das nicht ein wunderbares Gefühl?" Erwachsene ticken da nicht anders: Wir alle tragen einen gewissen Racheinstinkt in uns. Für Natalie Knapp ist das kein Beinbruch, „sondern tatsächlich ein biologischer Impuls“. Der ursprüngliche Sinn dieses Racheinstinkts lag darin, ein paar andere Instinkte in Schach zu halten, damit wir überhaupt in Gemeinschaften leben können.
Heute muss unser Gerechtigkeitssinn etwa das Gefühl in Schach halten, zu kurz gekommen zu sein. Das kennt fast jeder. „Die Folge davon ist, dass wir uns manchmal mehr nehmen als wir wirklich brauchen“, mahnt Knapp. Oder das „Ich-bin-besser-als-Syndrom“. Knapp nennt es die soziale Seuche unserer Tage: „Wenn sich diese Besserwisserei dann an den Racheinstinkt koppelt, der uns ein kostenloses Wohlgefühl beschert, wird es richtig ungemütlich in den antisozialen Medien.“
Der Wunsch nach Rache spielt auf dem langen Weg zum Verzeihen meist eine wichtige Rolle. Und Natalie Knapp unterstreicht, „dass es nichts Ehrenrühriges ist, sich Vergeltung zu wünschen“. Bleibt nur die Frage: Wie viel Vergeltung ist genug? Täter und Opfer sitzen einander wie auf einer Schaukel gegenüber, die nie ins Gleichgewicht kommt. Man muss schon von der Schaukel runtersteigen – „und genau das ist es, was Verzeihen eigentlich bedeutet“.
Im Moment des Verzeihens opfert das Opfer seinen eigenen sogar neurobiologisch verankerten Wunsch nach Gerechtigkeit. Im Verzeihen liegt ein echter Verzicht. Knapp: „Das Verzeihen ist zutiefst ungerecht. Daher ist es auch so schwer.“ Steigt das Opfer von der Schaukel, befreit es sich von der emotionalen Bindung an den Täter. Die erlittene Verletzung wird dadurch nicht ausgelöscht. Das ist in den Augen Knapps auch gut so, „denn es sind unsere Verletzungen, die uns die Chance geben mitfühlend zu werden“. Dass ich jemandem verzeihe, bedeutet auch nicht, dass ich das Vergehen entschuldige. Die Frage der Schuld sollen die Gerichte klären.
Natalie Knapp hält Verzeihen und Vergebung strikt auseinander. „Im Verzeihen verzichtet das Opfer auf Gerechtigkeit. Die Vergebung hingegen entlastet auch die Täter. Das ist noch schwieriger und scheint mitunter unmöglich." Und doch: Selbst Opfer des nationalsozialistischen Terrorregimes wie Edith Eger oder Viktor Frankl haben ihren Peinigern vergeben.

Jemandem zu verzeihen, wird selten durch große Gesten erreicht, sondern wird häufig als innere Bewegung erlebt. Die äußeren Gesten sollte man eher behutsam einsetzen. Wir alle kennen diese großartige Geste, die besagt: „Du hast zwar alles falsch gemacht, aber ich verzeih Dir du Sünder!“ Das wirkt beschämend, demütigend. Wer verzeiht, braucht Fingerspitzengefühl. Viele Kulturen haben sich dafür Rituale ausgedacht. Natalie Knapp erinnert an Jom Kippur, den Versöhnungstag. Am höchsten jüdischen Feiertag haben die Gläubigen zehn Tage vor diesem Termin Zeit, um alle Menschen um Vergebung zu bitten, die sie im vergangenen Jahr verletzt haben.
… und zwar die Opfer, die Täter und die Zeugen. Natalie Knapp muss in dem Zusammenhang an einen Satz ihrer Mutter denken: „Ich habe in meinem Leben das Verzeihen gelernt und es hat mir vor allem eines gebracht: Freiheit.“ Ihre Geschichte hat Knapp gelehrt, sich über das Verzeihen oder nicht Verzeihen eines anderen Menschen kein Urteil mehr zu erlauben: „Wir sollten es den anderen nicht schwerer machen als es ohnehin ist.“
„In den meisten Fällen ist es ungeheuer wichtig, die Emotionen zu fühlen, die eine Verletzung hinterlässt“, sagt Natalie Knapp: „Die Wut, die Trauer, den Schmerz oder auch den Wunsch nach Vergeltung.“ Denn die Emotionen bergen eine wichtige Information: „Sie zeigen uns, dass hier etwas ins Ungleichgewicht geraten ist, das dringend beachtet werden sollte.“ Das ist hilfreich. Sie setzen uns in Bewegung. Wer sie freilich ungebremst toben lässt, riskiert, regelrecht vergiftet zu werden.
Natalie Knapp glaubt zutiefst daran, „dass uns der Prozess des Verzeihens dem Geheimnis des Menschseins näherbringen kann als vieles andere“. Bleibt denn der Mensch ein Geheimnis? Ja, sagt Knapp und wenn wir das akzeptieren, ohne den letzten Winkel ausloten zu wollen, entwickeln wir „eine Zärtlichkeit für das Anderssein des Anderen. Der andere Mensch ist gerade deshalb so besonders, weil er der andere bleibt. Unsere Einzigartigkeit hat etwas Absolutes und Heiliges.“
Wenn es den Menschen im einen oder anderen Fall trotz allem nicht gelingt, den Anderen ihr unverständliches Anderssein zu verzeihen, dann kennt Natalie Knapp noch eine weitere Möglichkeit, sich dem Verzeihen anzunähern: Man kann versuchen, dem Leben zu verzeihen, dass es nicht perfekt ist. Wir leben nicht in einem vorherbestimmten Marionettentheater, „sondern in einem schöpferischen Universum, in dem alles mit allem in Beziehung steht. Da gibt es soziale Kettenreaktionen, die Jahrhunderte überdauern, aber auch besondere Momente, in denen aus einer einzigen gelingenden Begegnung etwas ganz Neues entsteht.“
Und das bedeutet für Natalie Knapp auch, dass es keinen perfekten Plan geben kann, der permanent alles aufeinander abstimmt. „In einem kreativen Universum kann auch einfach mal etwas schiefgehen. Das ist eine zentrale Schattenseite der Freiheit.“ Und es geht leider auch nicht immer gerecht zu. „Aber wir haben als Menschen eine Möglichkeit, die über die Gerechtigkeit hinausreicht, und das ist das Verzeihen.“
Edith Eva Eger "Ich bin hier, und alles ist jetzt: Warum wir uns jederzeit für die Freiheit entscheiden können" – Die erfolgreiche Psychologin und weltweit gefragte Rednerin Dr. Edith Eger ist eine der letzten Überlebenden des Holocaust. Sie ist das Mädchen, das vor dem KZ-Arzt Dr. Mengele um sein Leben tanzen musste. Ihre erschütternde Geschichte ist ein zutiefst bewegendes Zeugnis des Sieges der Menschlichkeit über den Hass und zeigt uns, dass wir im Leben immer die Freiheit haben, uns zu entscheiden.
Penguin Verlag
Susanne Boshammer: "Die zweite Chance: Warum wir (nicht alles) verzeihen sollten" – Können und sollten wir alles verzeihen? Werden wir uns selbst und anderen damit in jedem Fall gerecht? Die Philosophin Susanne Boshammer hat da ihre Zweifel.
Rowohlt Verlag
Tyson Yunkaporta: " Sand Talk – Das Wissen der Aborigines und die Krisen der modernen Welt" Darüber sagt Natalie Knapp: „Ein philosophisches Buch, das die europäische Weltsicht ver-rücken kann“ Matthes & Seitz, Berlin

Bildung
Wenn Lars Amend spricht, wird es ganz still. Er spricht über „Dieses bescheuerte Herz“. Der Film lockte Millionen ins Kino. Es ist seine Geschichte. Seine und die von Daniel, der im Film David heißt. Der mit einer Herzleistung von 9 Prozent noch immer lebt, gegen alle Prognosen. Es ist eine Geschichte der Hoffnung.
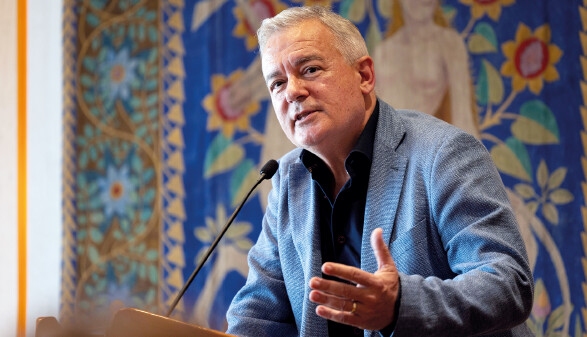
Bildung
Wir sollten wieder Utopien entwickeln. Der deutsche Autor und Übersetzer Ilija Trojanow meint dieses „Das kann doch nicht alles gewesen sein“. Der Satz greift Herrschaftsstrukturen an: Der neoliberale Kapitalismus ist wie die Herrschaft von früher davon überzeugt, dass er ohne Alternative ist. Was für ein Irrtum!

Bildung
Hoffnung tut not. Davon ist Andreas Krafft überzeugt. Wenn er Jugendliche dazu bringt, ihre eigenen Stärken zu entdecken, erlebt er Aha-Effekte am Fließband. Er kann ihr Selbstvertrauen förmlich wachsen sehen. So werden sie befähigt, ihre Zukunft selbstständig zu gestalten.
© 2026 AK Vorarlberg | Widnau 4, 6800 Feldkirch | +43 (0) 50 258