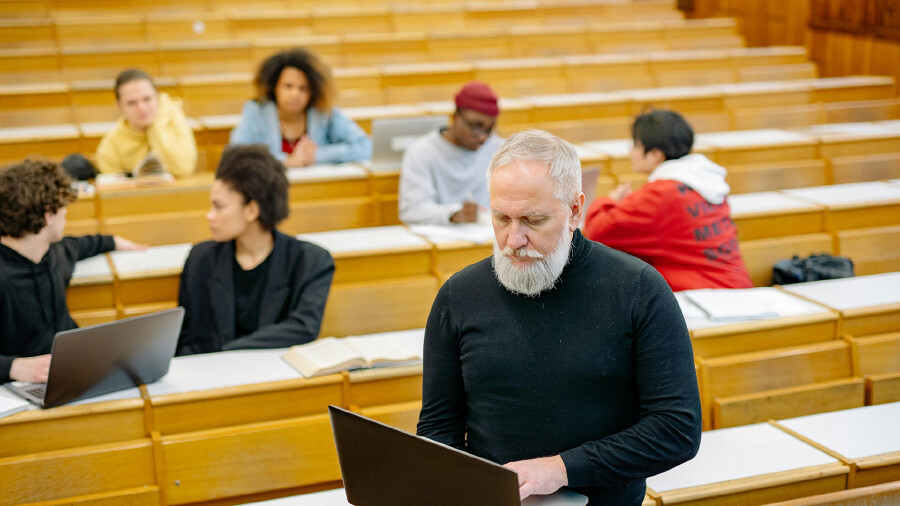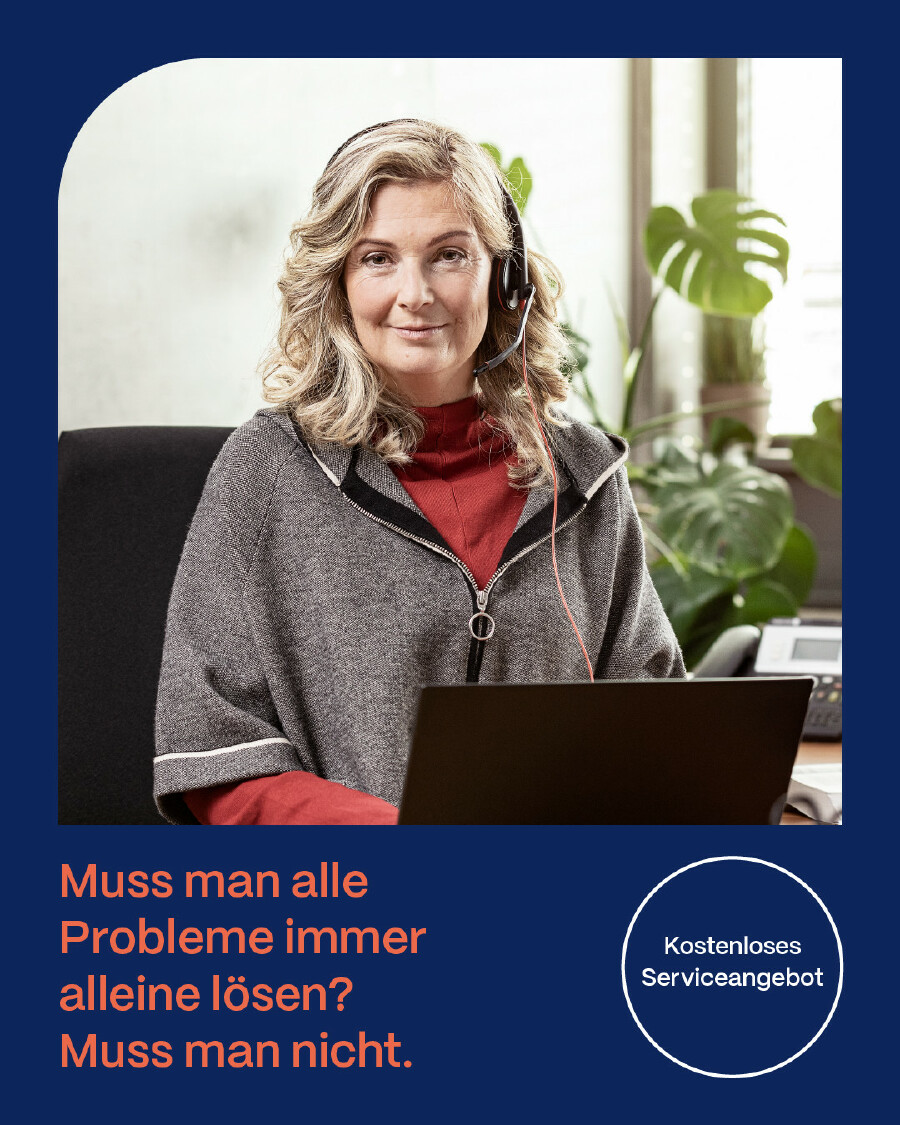3.7.2025
Arbeit
Barbara Knittel (85): „Ich arbeite nicht, weil ich muss – sondern weil ich darf“
Arbeit,Arbeitskultur,Arbeitszeit,Begegnung,Frau,Gesellschaft,Interview,Pension
Ein Gespräch mit Mag. Barbara Knittel über den Wert von Arbeit, die Freiheit im Alter – und den Sinn von Muße.
Eigentlich könnte Barbara Knittel seit über 20 Jahren in Pension sein. Doch wer sie trifft, merkt schnell: Diese Frau ist alles andere als im Ruhestand – sie steht mitten im Leben. Die evangelische Theologin, Psychologin und erfahrene Psychotherapeutin arbeitet weiter in ihrer Praxis. Nicht, weil sie muss. Sondern weil sie noch etwas zu geben hat.
Beim Übergang zur Pension helfen wir Dir gerne!
Melde dich jetzt für den kostenlosen AK Newsletter an und sichere dir damit wertvolle Informationen.
Frau Knittel, Sie sind 85 Jahre alt und könnten sich längst zurücklehnen – warum tun Sie es nicht?
Knittel: Ich erlebe mich als sehr privilegiert, weil ich einen Beruf habe, der mich nach wie vor so interessiert und in dem ich in Begegnungen erlebe, dass das Älterwerden auch große Möglichkeiten in sich birgt. Den Leuten anders zuzuhören zum Beispiel, von meinem Leben, von meiner Situation her. Ich kann heute vieles in einem größeren Kontext sehen. Ich werde diese Arbeit so lange machen, solange die Kräfte reichen und ich den Menschen etwas geben kann.
Wenn Sie sich vergleichen wollten mit der ganz jungen Barbara Knittel, die in den Beruf eingestiegen ist. Wo würden Sie die größten Unterschiede sehen?
Knittel: Die Psychotherapie ist ja mein Zweitberuf. Mein erster Beruf war der einer evangelischen Theologin, aber ich habe gemerkt: Meine Begabung liegt mehr darin, direkt mit Menschen zu arbeiten. Dann habe ich Psychologie studiert auf recht abenteuerliche Weise. Das war damals nicht so selbstverständlich, als externe Studentin aufzutreten. Ich bin also an die London University gegangen und hab dort die experimentelle Psychologie und die Statistiken absolviert, alles andere war Eigenstudium. Ich war damals sehr neugierig und sehr leistungsbezogen. Das hat sich bis heute wesentlich gemildert. Ich habe als junge Therapeutin von mir und von den Menschen verlangt, dass sie Wege der Veränderung gehen. Ich habe viel strukturierter gearbeitet als heute, mit mehr Anstrengung, mit mehr Forderung, mit viel stärkeren Bildern auch in mir, wie Menschen sich entwickeln sollten. Heute habe ich einen anderen Blick: Wo stehen Menschen in ihrem Lebenskontext? Was hat sie geprägt? Womit sind sie sehr involviert? Mein Blickwinkel hat sich geweitet. Heute frage ich: Was könnte sich in ihrer Situation an Lebensmöglichkeiten noch entfalten?
Sind Sie gnädiger geworden?
Knittel: Ja, mit mir, aber auch mit anderen.
Was motiviert Sie konkret – auch an Tagen, an denen es schwerer fällt?
Knittel: Ich habe so den Eindruck, dass ich ein Potenzial in mir trage, das ich gerne investieren möchte. Und ich merke, dass ich im Kontakt mit Menschen Unvorhersehbares, Ungeahntes auch viel intensiver erfahren kann. Ich gehe aus vielen Therapiestunden richtig belebt heraus, weil ich merke: Da ist dann etwas zu mir herübergekommen. Wenn ich freilich zu viel will, gehe ich müde aus diesen Stunden raus. Wenn ich zu stark an meinen Konzepten hänge, dann ermüdet mich das. Ich versuche heute nicht mehr an Lösungen zu arbeiten, die nicht in den Menschen drinnen sind. Heute dominiert eher dieses gemeinsame Stehenbleiben, auch die Ohnmacht einmal zulassen. Früher war mein Impuls: Da muss doch etwas zu machen sein! Heute geht es darum, sich Zeit zu lassen, zu entdecken, wo der nächste Schritt liegen könnte. Und auch zu akzeptieren, dass manche Menschen sehr lange brauchen, bis sie überhaupt ein Stückchen am Wesentlichen ihrer selbst rühren können. Und es gibt Menschen mit sehr schweren psychischen Erkrankungen. Das zu erkennen und dann nicht zu verlangen, wir müssen jetzt zu einer Lösung kommen, das gelingt mir heute leichter als früher.
Zuverdienst in der Pension
Pensionist:innen dürfen auch arbeiten. Was sie dabei beachten müssen, erfahren Sie bei der AK Vorarlberg
Was bedeutet Ihnen Arbeit – unabhängig von Einkommen oder gesellschaftlichem Status?
Knittel: Es gehört zu unserem Menschsein, dass wir sehr unterschiedliche Potenziale in uns haben. Und ich merke immer, wenn Menschen ein Stück davon zur Entfaltung bringen: Dann blühen sie wieder auf. Wenn das Potenzial aber brach liegt oder da so Schablonen darauf lasten, wie man sein Leben zu gestalten hat, dann hab ich den Eindruck, es vertrocknet einiges. Älterwerden ist ja ein unglaublicher Übergang: Es bedeutet, in eine Lebensphase einzusteigen, in der man sich mit der eigenen Endlichkeit beschäftigt, aber auch die Frage stellt: Welches Potenzial steckt da noch in mir?
Sie sprechen in mehrfacher Hinsicht aus persönlicher Erfahrung.
Knittel: Ich bin ja im Krieg geboren, der Tod war damals allgegenwärtig. Als ganz kleines Kind schon habe ich den Verlust meines Vaters erlebt. Ich habe später eine 17-jährige Tochter verloren. Ich wusste früh, dass das Leben nicht selbstverständlich ist. Jetzt ist es noch einmal deutlicher geworden: Ich kann nicht mehr viel in die Zukunft planen. Ich weiß nicht, wie es übermorgen sein wird. Das Heute hat eine unglaubliche Bedeutung erlangt.
Unser System signalisiert unterschwellig, dass der Mensch von einem Tag auf den anderen aufhört, berufstätig, kreativ zu sein.
Knittel: Das ist eine regelrechte Ideologie, die wir da haben. Ich glaube, die Wahrheit ist ganz individuell: Ich verstehe Menschen sehr gut, die eine Arbeit gemacht haben, mit der sie sich kräftemäßig übernehmen mussten, oder die gelangweilt ihren Job erledigt haben. Dass da erst einmal die Sehnsucht da ist, „jetzt muss ich nicht mehr zu bestimmten Zeiten aufstehen“, das versteh ich sehr gut. Aber dabei kann es nicht bleiben. Das fände ich gefährlich. Dieses Verkümmern von Potenzialen im Alter ist auch mit Erkrankung verbunden. Wir alle kennen Lebensbilder und Sehnsüchte, die immer da waren, aber im Alter dann gar nicht aufgehen. „Das mach ich dann, wenn ich einmal in Pension bin…“
Östereich kennt eine ganze Reihe von Pensionsarten. Die AK bietet einen fundierten Überblick.
Ist der Zeitpunkt der Pensionierung auch der Augenblick, an dem ich über die Bücher gehe und nachdenke: Was steckt denn noch in mir?
Knittel: Es kommen Leute zu mir, die genau an dieser Grenze stehen: Mit denen gilt es nun zu entdecken, wie das jetzt weitergehen könnte. Wie könnte ein Engagement ausschauen? Das kann Erwerbsarbeit sein, muss aber nicht. Was möchte da noch in Ausdruck kommen und gelebt werden, ist die zentrale Frage. Es geht nicht darum, sich in Schablonen immer wiederzufinden. Bei Frauen sind es dann oft die Familie und die Enkel. Das kann sehr schön sein, aber als Lebensziel stelle ich das in Frage. Es geht vielmehr darum: Was wohnt denn da in mir? Was ist denn brach liegen geblieben in mir? Dabei darf man nicht ausufern in seinen Ideen, sondern sollte realitätsnahe bleiben. Das ist oft ein Hindernis: Die Ideen sind viel zu groß, als dass sie mit konkreten Schritten angegangen werden könnten.
Braucht es Mut?
Knittel: Ja! Meine Arbeit versehe ich auch darin, Menschen zu ermutigen! Es braucht auch wirklich gute Freundinnen und Freunde, die einem da ein Stück weit zuschauen. Wenn es nicht möglich war, über die Jahrzehnte Freundschaften zu entwickeln, dann sollten die Betreffenden schauen, wo sie realistische Rückmeldungen kriegen, wo sie gesehen und bestätigt werden, kritisiert werden.
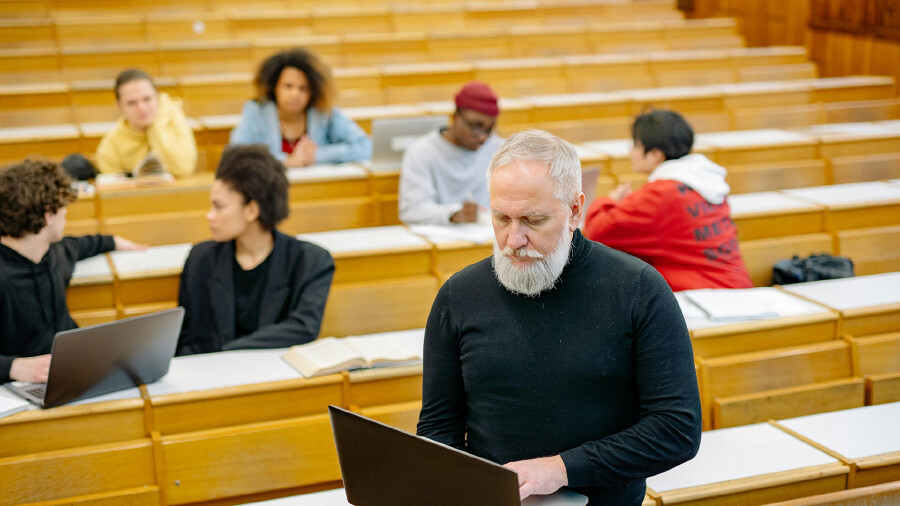
Seniorenstudien boomen: Insgesamt 5200 Frauen über 55 und Männer über 60 waren 2024 an Österreichs Unis eingeschrieben, so viele wie nie zuvor. © Yankrukov, pexels.com
Hatten Sie selbst nie das Bedürfnis, noch einmal etwas ganz anderes zu machen?
Knittel: Ich wollte ein Stück noch mehr medizinisches Wissen erwerben, etwa darüber, was man tun kann, wenn Menschen unter Schmerzen leiden. Auch an ein Altersstudium habe ich gedacht, weil mich so vieles interessiert. Philosophie zum Beispiel. Aber ich muss mich zügeln, weil die Zeit nicht für alles reicht.
Und was bedeutet Ihnen die freie Zeit – Muße, Rückzug, Innehalten?
Knittel: Viel. Ich stehe um sieben oder halb acht auf, zieh mich an, geh hinaus und gehe, einfach nur, um der Natur in ihrem Wandel zuzuschauen. Ich mache meine Runde und merke, wie ich gedanklich mir Zeit lassen kann. Da taucht oft etwas auf in mir, das ich gar nicht vermutet hatte. Oder ich staune einfach. Dann hole ich mir einen Kaffee und trink den im Park und schau einfach, was sich da abspielt. Dann gehe ich wieder heim. Ich beginne keine Therapiestunde vor halbzehn. Zwischendurch schaffe ich mir Lebensinseln. Etwa mit meinem Mann zwei, drei Tage wegfahren. Gerade hatten wir Freunde da und sind mit denen in die Berge gegangen. Die Pension gestattet ja eine völlig andere Zeitgestaltung.
Sind sie mit Smartphone unterwegs?
Knittel: Morgens beim Spaziergang? Nein! Ansonsten verlange ich von mir, dass ich mich ein wenig auskenne darin. Aber ich bewege mich wenig in den sozialen Medien.
Viele Menschen erleben die Pension als Bruch – im Selbstbild, im Alltag. Was hilft beim Übergang?
Knittel: Es ist tatsächlich eine enorme Identitätsveränderung. Das Berufliche prägt ja sehr. Mit dem Tag der Pensionierung bist Du dann plötzlich nicht mehr der oder die. Jetzt stellt sich die Frage: Wer bin ich denn dann, wenn ich diese Zuschreibungen nicht mehr habe? Wie ist es mit dem Wert, den ich mir selbst gebe? Da liegen große Chancen drinnen. Da muss ich aber ein Stückchen tiefer graben, zu einem anderen Umgang finden mit Zeit und Endlichkeit, aber mich auch wirklich verabschieden innerlich: Ich bin nicht mehr der, der ich vorher war. Ich ermutige die Leute, sich Zeit zu lassen. Sich nicht gleich vollzuladen. Dieser Abschied ist ein ganz wichtiger Prozess. Vielleicht sind da ja auch noch einiger Frust und einige Trauer.
Ist es der Augenblick, um über die Bücher zu gehen?
Knittel: Ich glaube, das eine ist, die Wertschätzung für sich noch einmal zu fühlen, aber auch zu schauen, wo ich eigentlich gescheitert bin. Wo sind denn Wünsche auf der Strecke geblieben? Erlittene Kränkungen bergen die Gefahr, zu verbittern. Wenn ich etwa meine Arbeit beenden musste, weil die mich loswerden wollten. Das braucht dann eine Zeit, bis ich aus dem Groll den Übergang finde.
Wie können Arbeitgeber bei einem anerkennenden und würdevollen Übergang mitwirken?
Knittel: Da gehört sich zunächst einmal eine Wertschätzung für all das, was die scheidenden Arbeitnehmer:innen ins Leben gebracht haben. Auf Seiten der Arbeitgeber wäre ganz wichtig, zu würdigen, was das für sie bedeutet hat, dass der oder die Betroffene für sie gearbeitet hat. Da passieren heute noch immer Übergänge, die ganz schlecht sind. Da wird dann so halb offen vermittelt: Eigentlich sind wir recht froh, dass wir dich loshaben.
Sie arbeiten mit Menschen, die sich selbst suchen oder verlieren. Wie erleben Sie dabei den Zusammenhang von Arbeit und Identität?
Ich staune oft, wie abwertend Menschen ihre geleistete Arbeit beurteilen. Dabei haben sie Lebenszeit und Lebensenergie investiert!
Mag. Barbara Knittel
Pschotherapeutin
Knittel: Es ist oft spannend, wie viel Abwertung sie für sich selbst aufbringen. Oft verlieren sie den Blick dafür, was sie eigentlich mit ihrer Arbeit bewirkt haben. Wie sie da eingebunden waren auch in viel größere Zusammenhänge, für wen und wofür. Diese Wertschätzung für die eigene Arbeit, auch wenn die manchmal frustrierend war, das geht ihnen oft verloren. Dabei haben sie ja Lebenszeit und Lebensenergie investiert. Ich staune, wie wenig Wertschätzung sie im Rückblick für ihre Arbeit haben. Sie sehen nicht, wie vielen Menschen ihre Arbeit zugute kam. Da geht etwas ganz Wichtiges verloren.
Hat unsere Gesellschaft genug Wertschätzung für Menschen im Ruhestand, die weiterwirken wollen?
Knittel: Ich finde das ein Stück phantasielos, was sich da abspielt. Darüber nachdenken, was für Potenziale mit den Menschen verschwinden, die da in Pension gehen, was da alles brach liegt… Im gesellschaftlichen Kontext ist dafür ganz wenig Phantasie da.
Um unseren Körper im Alter auf Vordermann zu bringen, gibt es künstliche Gelenke, Herzschrittmacher und vieles mehr. Wie können wir die Seele in Schuss halten?
Knittel: Für mich gehört das zusammen. Die Trennung von Körper und Seele ist ein bisschen absurd. Für mich persönlich war es sehr wichtig, dass ich so mit 45, 50 erkannt habe: Jetzt musst Du körperlich etwas tun, das Dir auch Freude macht. Etwas finden, wo ich mich spüre, das nicht nur eine Qual ist, oder sich darin erschöpft, dass ich strahlend fit ausschaue. Sondern etwas, was ich gerne mache. Für mich ist die Schönheit sehr wichtig – in der Natur, in der Kunst, in der Dichtung, auch im Leben. In der Pension habe ich wirklich die Möglichkeit, über nicht so schnelle Zeitgestaltung, vielleicht auch einmal über Langeweile, das zu entdecken, was wir Muße nennen. Was mich beglückt. Und dann verweilen, verlangsamen. Neben unserer getakteten Zeit erfahren, dass es da noch ganz andere Zeitrhythmen gibt.
Was müsste sich strukturell ändern, damit ältere Menschen sich freier entscheiden können – für Arbeit oder für Ruhe?
Knittel: Unsere Bilder von Pension und Alter dürfen nicht so geprägt sein von „jetzt gibst Du bald den Löffel ab“. Die Erfahrung alter Menschen aus ihrem Berufsfeld wird viel zu wenig abgerufen.
Wie empfinden Sie den Dialog zwischen Jung und Alt?
Im Dialog zwischen Jung und Alt ist die gegenseitige Abwertung eine Unkultur. Sie verhindert einen wertvollen Austausch.
Mag. Barbara Knittel
Psychotherapeutin
Knittel: Die Alten müssen lernen, dass die Jungen ganz andere Lebensformen haben. Die gegenseitige Abwertung ist eine Unkultur. Es braucht stattdessen ein Bewusstsein, dass ich von meinem jeweiligen Leben her einen begrenzten Blickwinkel habe. Vieles von dem, was die Jungen jetzt erleben, kann ich, wenn ich neugierig bin, wenigstens zum Teil erfragen. Aber ich bin nicht mehr drinnen. Und die Jungen wiederum wissen nicht, wie das so ist nach einer langen Lebensstrecke. Die gegenseitige Abwertung verhindert den wertvollen Austausch. Die Bilder vom Alter, die wir haben, sind im Übrigen stark von Verlust geprägt. Du lebst natürlich anders, musst aufs Knie, auf die Hüfte schauen. Aber es ist nicht nur Verlust, es ist eine andere Art zu leben. Ich weiß zum Beispiel, dass ich einen Haufen Bücher herumliegen hab, die ich in meinem Leben nimmer mehr lesen werde.
Aber Sie kaufen noch neue?
Knittel: Ja, leider! Die Neugierde ist einfach zu groß.
Zum Schluss: Was möchten Sie Menschen mitgeben, die sich auf den Ruhestand vorbereiten?
Knittel: Ich bereite sie darauf vor, dass es einigen Mut braucht, sich mit sich selbst noch einmal eingehend zu befassen. Wovon muss ich mich wirklich verabschieden? Was für eine tiefe Persönlichkeitsveränderung kann das sein? Das kann auch dauern. Aber es lohnt sich!
DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN

06.05.2025
Arbeit
Länger Arbeiten braucht ein gutes Umfeld
Wie lange werden wir künftig arbeiten? Steckt im Cartoon vom Hochbetagten, der sich auf dem Weg zur Teamsitzung verirrt, ein Körnchen Wahrheit? Ein Blick in die Arbeitswirklichkeit rückt ungezügelte Fantasien zurecht.

10.6.2025
Arbeit
Vom guten Übergang in die Pension
Die Pension naht – und mit ihr ein ganzes Arsenal an Klischees, Ratschlägen und Erwartungen. Doch was bleibt vom Menschen hinter der Berufsrolle, wenn der letzte Arbeitstag vorbei ist?